+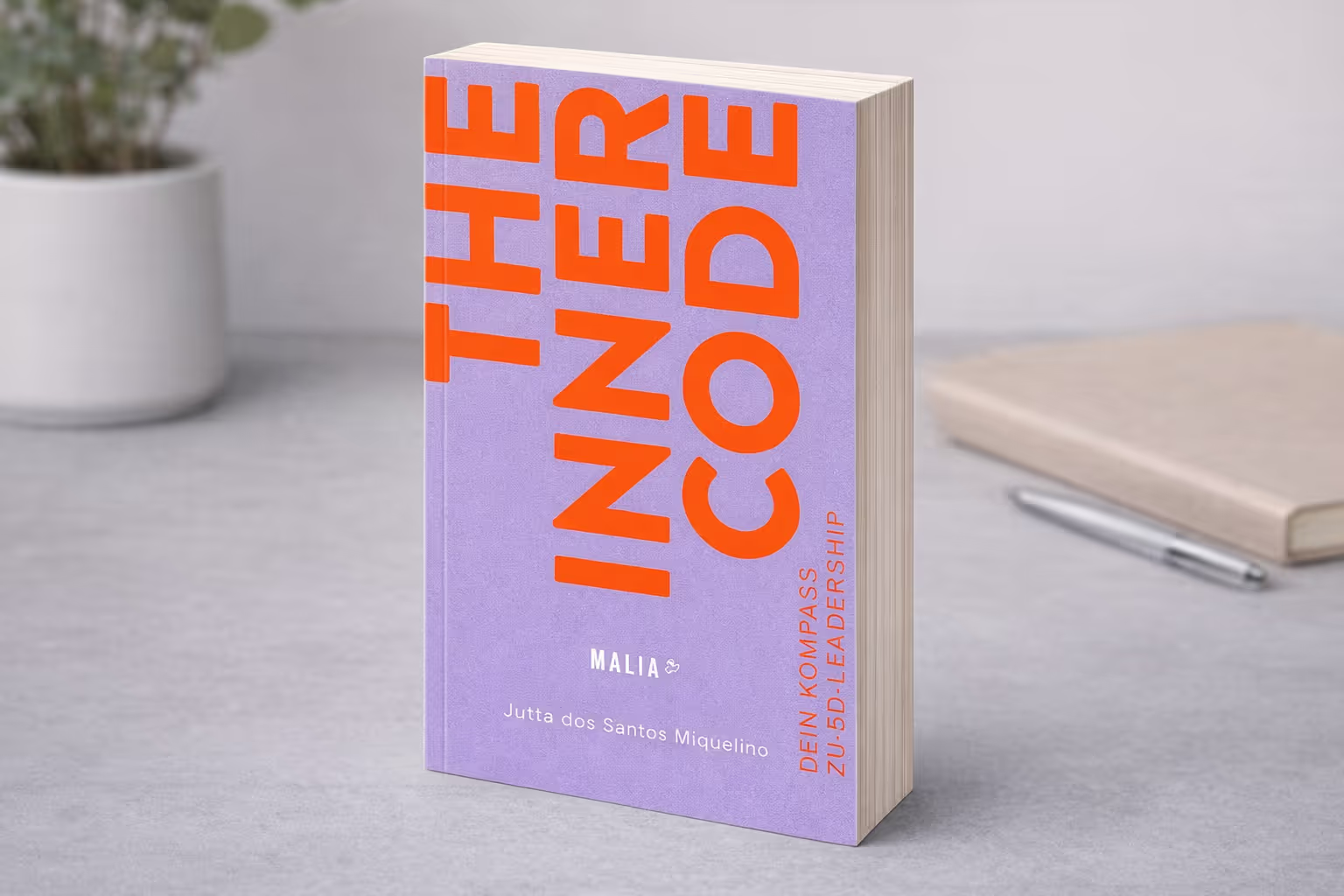
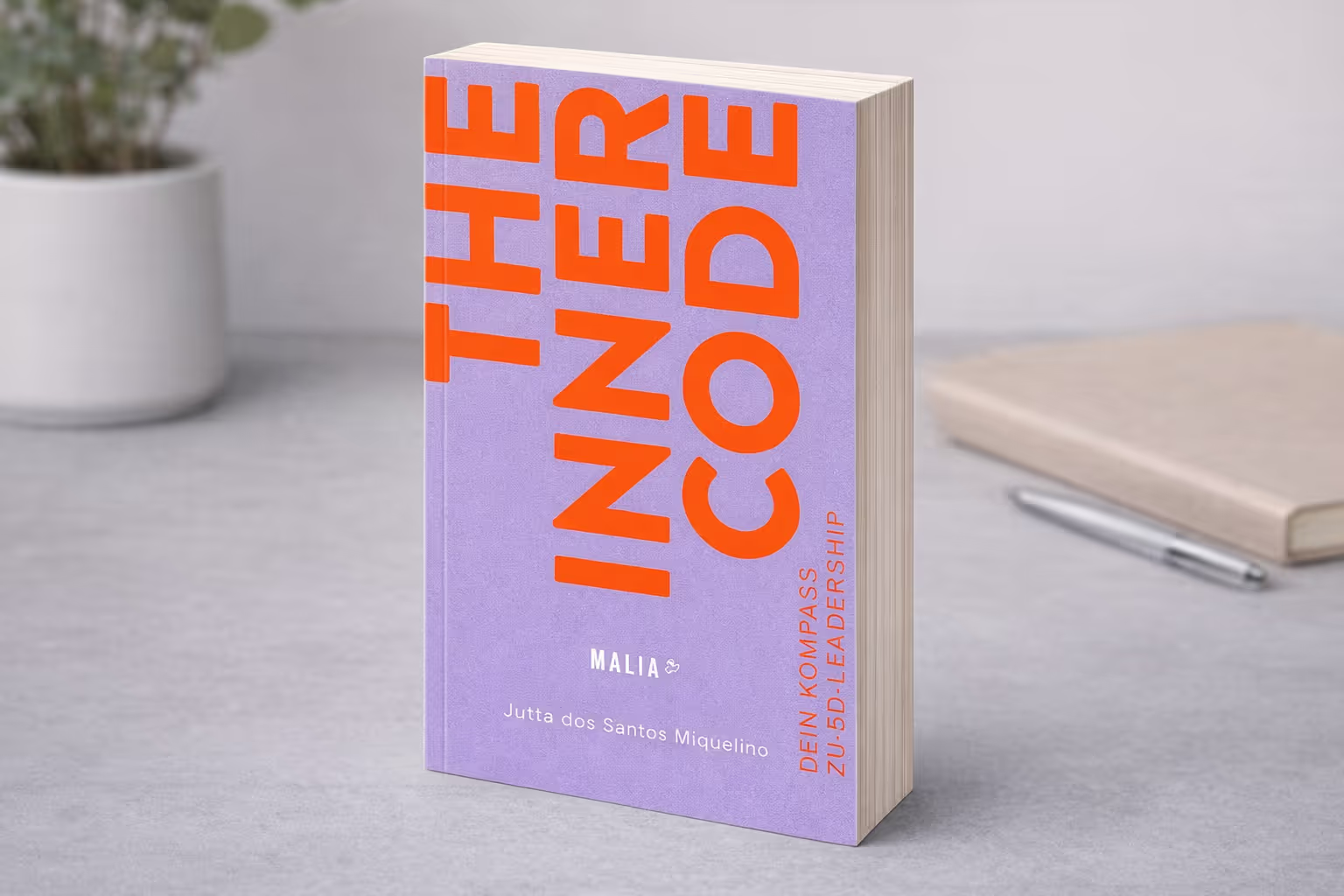
Führung beginnt im Inneren
The Inner Code zeigt, warum Klarheit der Ausgangspunkt jeder wirksamen Führung ist und was passiert, wenn Haltung und Bewusstsein zur Grundlage von Leadership werden.
JETZT VORBESTELLEN
Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, Produktivität und Innovationskraft auf ein völlig neues Niveau zu heben. Anfang 2025 beziffert McKinsey das langfristige globale Potenzial von KI auf bis zu 4,4 Billionen US-Dollar, doch gerade einmal rund 1 % der Unternehmen fühlt sich heute wirklich „KI-reif“. Einer der Hauptgründe für diese Diskrepanz ist dabei nicht die fehlende Technologie oder mangelndes Talent, sondern eine Führungsphilosophie, die den gezielten Einsatz von KI ermöglicht und Teams befähigt, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Hier kommt der Begriff „Superagency“ in Spiel. Dieser Begriff beschreibt die Fähigkeit von Mensch und Maschine, gemeinsam mehr zu leisten, als jede Seite für sich allein könnte. Geprägt von Reid Hoffman in seinem Buch „Superagency: What Could Possibly Go Right with Our AI Future“, steht er für eine optimistische Vision, in der KI-Systeme Menschen nicht ersetzen, sondern Handlungsspielräume erweitern und kreative Potenziale freisetzen. Für Führungskräfte bedeutet das, bewusst Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Teams und KI-Tools in echter Ko-Kreativität zusammenarbeiten können.
Wer Superagency leben möchte, darf KI also nicht nur als Tool im Werkzeugkasten sehen, sondern muss es als strategisches Element einsetzen, welches von der Vision bis hin in den Arbeitsalltag wirkt. Genau hier setzt das Konzept von „AI-First Leadership“ an. Ein AI-First Leader zu sein, bedeutet vor allem zu lernen, wie man ein Umfeld schaffen kann, in dem Menschen und KI-Tools synergetisch und auf ganzer Ebene zusammenarbeiten.
AI-First Leadership bedeutet auch, die eigene Rolle als Treiber der Transformation konsequent zu hinterfragen und KI-Initiativen nicht einfach abzunicken. Stattdessen sollten sich Führungskräfte regelmäßige „KI-Reviews“ in ihren Kalender setzen, in denen sie die laufenden KI-Projekte systematisch auf vier Kriterien prüfen:
Anhand dieser Reviews lässt sich erkennen, welche Vorhaben tatsächlich zur Superagency-Vision beitragen und wo nachjustiert werden muss (McKinsey 2025).
Erst wenn diese AI-First-Grundlagen gelegt sind, können Teams wirklich in ihre Rolle als Superagent:innen hineinwachsen. Der nächste Schritt ist deshalb, die operativen Einheiten bzw. die Bereiche, auf die man sich geeinigt hat, auszustatten und zu empowern mit klaren Zielen und der Freiheit, Methoden und Tools selbst zu wählen, um die in der Roadmap definierten KI-Pilotprojekte umzusetzen. So entsteht ein nahtloser Übergang von der strategischen Vision zur tatsächlichen Umsetzung und das Konzept der Superagency wird in der täglichen Teamarbeit greifbar.
Damit KI-Initiativen wirklich langfristig funktionieren, müssen strategische Ziele, Unternehmensstruktur und die gelebte Kultur Hand in Hand gehen. Führungskräfte können dies fördern, indem sie gezielt auf folgende Punkte achten:
Cross-funktionale Zusammenarbeit verankern
Statt KI-Projekte isoliert in ein IT-Team zu schieben, sollten Leader Unternehmensstrukturen so anpassen, dass gemischte, multidisziplinäre Teams gebildet werden können, in denen Entwickler:innen, Fachexpert:innen, Produktverantwortliche etc. von Anfang an gemeinsam an KI-Use-Cases arbeiten können. Dabei lohnt es sich auch ein kleines Kern-Team festzulegen, welches sich eimal pro Woche trifft, um direktes Feedback aus den Fachbereichen einfließen zu lassen.
Kultur des Vertrauens fördern
Da eine vertrauensvolle Kultur das Fundament erfolgreicher KI-Initiativen bildet, gilt es, ein lernfreudiges Miteinander zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeitenden sicher und eingebunden fühlen. Dafür ist es wichtig, dass Führungskräfte eine offene Fehlerkultur etablieren, in der Fehltritte als Lernchance verstanden und in „Retroperspektiven“ offen diskutiert werden. Hierbei helfen regelmäßige Feedback-Runden und transparente Informationsweitergabe, sodass alle immer auf demselben Wissensstand sind. Auch die aktive Einbindung von Mitarbeitenden in Entscheidungsprozessen ist ein wichtiger Aspekt, um nicht nur Vertrauen im Unternehmen sondern auch Verantwortung weiter zu stärken.
Change-Management und Skill-Building stärken
Um die Einführung dieser neuen Prozesse zu erleichtern, lohnt es sich für Leader an dieser Stelle strukturierte Change-Programme mit Workshops zu KI-Grundlagen einzuführen und parallel ein Mentor:innen Netzwerk aufzubauen, bei den bereits mehr erfahrene Kolleg:innen als Anlaufstelle für Fragen und Best Practices fungieren können. Um die Mentor:innen nicht zu überlasten, können regelmäßig Micro-Learning-Module oder „Lunch-&-Learn“-Sessions angeboten werden, in denen KI-Anwendungen direkt im Arbeitsalltag erprobt und neu erworbene Kenntnisse sofort angewendet werden. Dadurch vermindern sich Berührungsängste, Fachkompetenzen werden bedarfsgerecht aufgebaut und die Bereitschaft, KI-Tools aktiv einzusetzen, wächst nachhaltig.
Führungskräfte sind gefordert, KI-Strategie, Organisationsstruktur und Unternehmenskultur konsequent zu verknüpfen. Indem sie AI-First Leadership fördern, multidisziplinäre Teams empowern, schnelle Pilotprojekte umsetzen und eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung etablieren, legen sie den Grundstein für nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. So wird aus der Vision einer „Superagency“ im Arbeitsalltag eine greifbare Realität zum Nutzen von Mitarbeitenden, Kunden und dem gesamten Unternehmen.